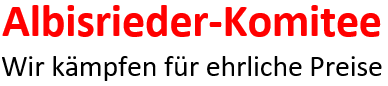Spezialärzte warnen, viele Eingriffe seien bald nicht mehr finanzierbar
 Sparen im Gesundheitswesen: Pauschalen für ambulante Eingriffe sollen den Anstieg der Prämien bremsen. Mediziner und Pharmaindustrie warnen vor Qualitätseinbussen und fordern eine Verschiebung des neuen Tarifs.
Sparen im Gesundheitswesen: Pauschalen für ambulante Eingriffe sollen den Anstieg der Prämien bremsen. Mediziner und Pharmaindustrie warnen vor Qualitätseinbussen und fordern eine Verschiebung des neuen Tarifs.
Lese dazu auch den NZZ Beitrag 29.4.2025 Markus Brotschi Rote Schrift und Zeichnung = Unsere Kommentare
Politik & Wirtschaft – Dienstag, 29. April 2025 – Markus Brotschi
15 Milliarden Franken oder gut ein Drittel der Krankenkassenprämien werden jährlich für ambulante Behandlungen in Praxen und Spitälern aufgewendet. Für diese ambulanten Leistungen führt der Bundesrat auf 2026 ein neues Tarifsystem ein. Den definitiven Entscheid trifft der Bundesrat demnächst. Die ganzen Tricksereien mit den unglaublichen, teilweise menschenverachtenden Tarifpositionen und den vielen geheimen Verträgen würden sich erübrigen, wenn die geldgierigen Direktionen ganz einfach und ehrlich – wie jede normale Unternehmung – die verbrauchte Zeit jedes an einer Leistung beteiligten Mitwirkenden verrechnen würden…wie hier! Aber eben, das ergäbe sehr viel weniger Geld!
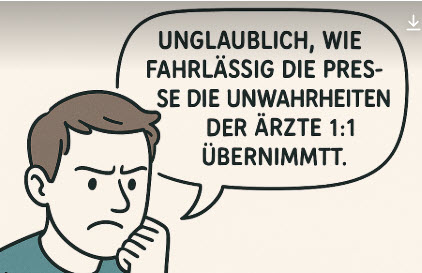 Damit wird ein grosser Streit zwischen den Verbänden der Krankenversicherer, Spitäler und der Ärzteschaft offiziell beendet. Doch hinter den Kulissen gärt es in der Ärzteschaft. Zwar hat die Delegiertenversammlung der Ärzteverbindung FMH dem neuen Tarif mit über 80 Prozent zugestimmt. Doch spezialärztliche Organisationen warnen vor den neuen Pauschaltarifen, die einen Fixpreis für bestimmte Eingriffe vorsehen. Bisher wurden ambulante Behandlungen mit Einzelpositionen abgerechnet, womit je nach Aufwand ein unterschiedlicher Preis resultierte. Das ist eben so: Gleichartige OP’s etc. können mehr oder weniger Zeit beanspruchen – niemand soll wegen des Entgeltes pressieren müssen.
Damit wird ein grosser Streit zwischen den Verbänden der Krankenversicherer, Spitäler und der Ärzteschaft offiziell beendet. Doch hinter den Kulissen gärt es in der Ärzteschaft. Zwar hat die Delegiertenversammlung der Ärzteverbindung FMH dem neuen Tarif mit über 80 Prozent zugestimmt. Doch spezialärztliche Organisationen warnen vor den neuen Pauschaltarifen, die einen Fixpreis für bestimmte Eingriffe vorsehen. Bisher wurden ambulante Behandlungen mit Einzelpositionen abgerechnet, womit je nach Aufwand ein unterschiedlicher Preis resultierte. Das ist eben so: Gleichartige OP’s etc. können mehr oder weniger Zeit beanspruchen – niemand soll wegen des Entgeltes pressieren müssen.
Warnung vor Zweiklassenmedizin
Die Pauschalen wiesen gravierende Mängel auf, welche die Qualität der ambulanten Versorgung in der Schweiz gefährdeten, warnen 29 medizinische Fachgesellschaften in einem offenen Brief. Es drohten Zweiklassenmedizin und Qualitätseinbussen. Die Pauschalen seien teilweise falsch kalkuliert worden. Aufwendige Behandlungen würden unrentabel, weil Pauschalen nicht kostendeckend seien. Eine Allianz aus spezialärztlichen Gesellschaften, des Pharmaverbandes Interpharma sowie der Vertretung der Privatspitäler (Ospita) fordert Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider auf, die Einführung der neuen Tarife auf 2027 zu verschieben, wie die NZZ berichtet.
Aus Ärztekreisen wird vereinzelt gar gedroht, dass Patienten für nicht kostendeckende Eingriffe an Spitäler abgeschoben würden. Oder dass aufwendigere Behandlungen auf mehrere Konsultationen verteilt würden, damit für jeden Schritt eine separate Pauschale verrechnet werden könne statt für die ganze Behandlung nur eine einzige. Traurig traurig!
Exemplarisch für solche Warnungen ist eine Stellungnahme von Retina Suisse, der Vereinigung für Menschen mit Augenerkrankungen. Die sechsseitige Warnschrift wurde mit der Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft abgesprochen, der Vereinigung der Augenärztinnen und -Ärzte. Als Beispiel wird die Behandlung der Altersbedingten Makuladegeneration (AMD) angeführt, an der viele ältere Menschen leiden und die zu einem Verlust der Sehschärfe führt. Behandelt wird die Erkrankung mit Injektionen ins Auge, die in Abständen von einigen Monaten in der ambulanten Praxis verabreicht werden.
Bisher wurde die Behandlung mit mehreren Tarifpositionen für die einzelnen Behandlungsschritte abgerechnet. Insbesondere konnten die Augenärztinnen und -Ärzte das verabreichte Medikament separat verrechnen. Neu wird die Behandlung mit einem Pauschalbetrag von rund 1300 Franken abgegolten. Dabei spielt es keine Rolle, welches Medikament injiziert wird, dessen Preis je nach Präparat zwischen 678 und 545 Franken variiert.
Hier setzt die Kritik an. Ärztinnen und Ärzte würden durch den fixen Preis dazu gedrängt, das günstigste Medikament einzusetzen. Dies sei im Fall der AMD ein sogenanntes Biosimilar, ein Nachahmerpräparat des biotechnologisch hergestellten Originals, sagt Stephan Hüsler, Geschäftsleiter von Retina Suisse. Je häufiger aber das günstigere Präparat verschrieben werde, desto tiefer werde die Pauschale. Denn die Pauschalen wurden als «lernendes System» konstruiert.
Die für das neue Tarifsystem gegründete Organisation ambulante Arzttarife (OAAT) überprüft regelmässig die Kosten einer Behandlung und passt den Preis an. Wenn bei der Behandlung der AMD häufig das günstigste Medikament gespritzt wird, sinkt die Pauschale.
Der so entstehende Preisdruck verunmögliche es künftig, dass Patientinnen und Patienten von neuen, wirksameren, wohl aber teureren Medikamenten profitieren könnten, warnt Hüsler. Zudem werde die Verschreibung des günstigen Biosimilars einen paradoxen Kosteneffekt haben. Weil das Nachahmerpräparat öfter als das Original injiziert werden müsse, seien pro Jahr mehr Konsultationen nötig und die Pauschale werde häufiger abgerechnet.
Haus- und Kinderärzte brauchen neuen Tarif
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verweist darauf, dass die Pauschalen einem Durchschnittswert der erfassten Fälle entsprechen. Es liege daher in der Natur der Sache, dass einige Fälle teurer und andere billiger seien als die für die Behandlung definierte Pauschale. Der Bundesrat dürfte trotz der Kritik an der Einführung des neuen ambulanten Tarifsystems auf 2026 festhalten. Sowohl das BAG wie auch die FMH verweisen darauf, dass allfällige Mängel bei den Pauschaltarifen von der Tarifkommission noch vor der Einführung behoben werden können.
Auch im Jahr nach der Einführung würden die Tarife laufend aktualisiert und gegebenenfalls angepasst, hält das BAG fest. Ob es gelinge, bis zur Einführung des neuen, komplexen Tarifsystems alle monierten Mängel zu beheben, sei zwar offen. Entscheidend sei aber, dass der völlig veraltete Tarmed abgelöst werde. Insbesondere Kinder- und Hausärztinnen und -Ärzte sowie Psychiaterinnen und Psychiater sind dringend auf die vorgesehenen Verbesserungen im neuen Regelwerk namens Tardoc angewiesen.
Dass neben dem neuen Einzeltarif Tardoc, der den über 20 Jahre alten Tarmed ersetzt, Pauschalen eingeführt werden, hat vor allem der Kassenverband Santésuisse erwirkt. Dieser opponierte lange gegen den Tardoc, der vom mittlerweile aufgelösten Konkurrenzverband Curafutura und der FMH ausgehandelt wurde. Die Pauschalen sollen Druck erzeugen, medizinische Leistungen kostengünstig zu erbringen.
Pauschalen gibt es für rund 120 häufige Eingriffe wie das Einsetzen eines Herzschrittmachers, die Operation des grauen Stars oder das Entfernen der Mandeln. Ein grosser Teil der Behandlungen wird jedoch weiterhin mit Einzelpositionen abgerechnet, vor allem Hausarztleistungen.
Veralteter Tarif begünstigt hohe Tomografen-Dichte
Dass der noch gültige Tarmed ersetzt werden muss, zeigt die Untersuchung der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) zum Einsatz von Computertomografen (CT) und Magnetresonanztomografen (MRT). Bildgebende Untersuchungen verursachten jährliche Kosten von 2,1 Milliarden Franken, was einem Sechstel der ambulanten Behandlungskosten entspricht. Davon entfallen 600 Millionen auf Ultraschall – sowie 850 Millionen auf CT- und MRT-Untersuchungen.
Als einen Grund für die grosse Zahl der Tomografen sieht die Finanzkontrolle den Tarmed. «Das günstige Tarifklima hat zur Entwicklung eines umfangreichen und komfortablen Angebots geführt», heisst es im Bericht. Der neue ambulante Tarif Tardoc werde zu tieferen Beiträgen an die Infrastruktur der Radiologieinstitute führen. Das BAG müsse jedoch genau verfolgen, ob dies nicht mit einer höheren Zahl von Untersuchungen kompensiert werde.
Titelseite
Spezialärzte warnen, viele Eingriffe seien bald nicht mehr finanzierbar
Sparen im Gesundheitswesen: Pauschalen für ambulante Eingriffe sollen den Anstieg der Prämien bremsen. Mediziner und Pharmaindustrie warnen vor Qualitätseinbussen und fordern eine Verschiebung des neuen Tarifs.
Einige ambulant durchgeführte Operationen werden künftig mit einem fixen Preis abgerechnet. Foto: Christian Jaeggi
2023 kostete das Schweizer Gesundheitswesen 94 Milliarden Franken, 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilt das Bundesamt für Statistik (BFS) gestern in einer Medienmitteilung mit. Das Gesundheitswesen wurde zu über 60 Prozent von den Haushalten finanziert, entweder direkt oder über die Krankenversicherungsprämien. Gemäss den Schätzungen des BFS dürften die Kosten 2024 um mehr als 3 Prozent ansteigen.
Die Kosten für Pflegeleistungen, die unter anderem in den Spitälern, Arztpraxen und sozialmedizinischen Institutionen erbracht werden, nahmen zwischen 2022 und 2023 um 6 Prozent zu. Der Anstieg der Kosten für Gesundheitsgüter wie Medikamente oder therapeutische Apparate war mit +3,4 Prozent etwas moderater. 2023 machten die Pflegeleistungen und die Gesundheitsgüter zusammen über drei Viertel der Kosten für Gesundheitsleistungen aus.
Weniger für Prävention
Für Prävention wurde 2023 insgesamt 53,5 Prozent weniger ausgegeben als im Vorjahr, das noch von der Covid-19-Pandemie geprägt war. Auf sie entfielen weniger als 2 Prozent der gesamten Gesundheitskosten 2023. Auch die Kosten für Laboranalysen waren rückläufig (-8,9 Prozent). Demgegenüber stiegen die Radiologiekosten weiter an (+7,0 Prozent). Die Zunahme der Verwaltungskosten, die hauptsächlich den Administrativaufwand der Krankenversicherer abdecken, fiel 2023 mit 9,6 Prozent besonders markant aus.
Spitäler waren mit 36,3 Prozent der Gesamtkosten die wichtigsten Leistungserbringer. Die Spitalkosten erhöhten sich zwischen 2022 und 2023 um 4,5 Prozent. Bei den Arztpraxen aller Fachrichtungen belief sich das Kostenwachstum auf 7,1 Prozent, bei sozialmedizinischen Institutionen auf 4,6 Prozent. Besonders stark fiel der Anstieg bei den Spitex-Diensten aus (+7,9 Prozent), wobei diese Kosten weniger als 4 Prozent der gesamten Gesundheitskosten ausmachten.
Kantonale Unterschiede
2023 waren die höchsten Gesundheitskosten im Kanton Basel-Stadt zu verzeichnen (13’600 Franken pro Kopf). Am anderen Ende der Rangliste fielen die Kosten im Kanton Zug nahezu 40 Prozent tiefer aus (8600 Franken pro Kopf). Der Kostenanteil für ambulante Leistungen lag zwischen 53,4 Prozent im Kanton Genf und nur 34,8 Prozent im Kanton Uri.
Die Privathaushalte sind der wichtigste Finanzierungsträger des Gesundheitswesens. Sie bezahlten 21,8 Prozent der Gesundheitskosten aus der eigenen Tasche und 39,5 Prozent in Form von indirekten Beiträgen, hauptsächlich über die Krankenversicherungsprämien. Der Restbetrag wurde weitgehend von den Kantonen übernommen. Die Gesundheitsausgaben der Haushalte stiegen zwischen 2022 und 2023 um 4,7 Prozent an, jene der Kantone um 1,9 Prozent.
Nicoletta Gueorguiev
——.——————————————————————————–
Zurück zur Hauptseite oder zum Inhalts/Stichwortverzeichnis
Diese Seite lebt. Bei neuen Erkenntnissen – zum Beispiel durch eine gute Anregung von Ihnen – erfolgt umgehend die notwendige Anpassung. Bitte benachrichtigen Sie Ihre Freunde in nah und fern.
![]()
![]()
![]() .
. ![]()
![]() Bei der sogenannten Karpaltunnelspaltung wird das Band – das Retinaculum flexorum –, das den Karpaltunnel hohlhandwärts begrenzt, durchtrennt. Dadurch wird der Mittelarmnerv nicht mehr eingeengt und kann sich erholen. Die Operation wird über einen 2-3 cm langen Schnitt an der Innenseite des Handgelenks durchgeführt.
Bei der sogenannten Karpaltunnelspaltung wird das Band – das Retinaculum flexorum –, das den Karpaltunnel hohlhandwärts begrenzt, durchtrennt. Dadurch wird der Mittelarmnerv nicht mehr eingeengt und kann sich erholen. Die Operation wird über einen 2-3 cm langen Schnitt an der Innenseite des Handgelenks durchgeführt.
Albisrieder-Komitee, Lyrenweg 61, 8047 Zürich, Tel 079 300 93 62. Mail: info@albisrieder-komitee.ch. Verantwortlich für Recherchen und Redaktion: Werner Bachmann..
.
.
.